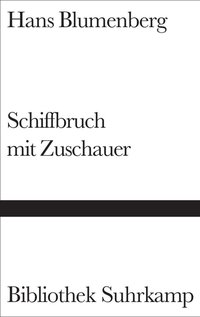Zum Buch:
Der Philosoph Hans Blumenberg (1929-1996) beschäftigte sich sein Leben lang mit Begriffs- und Wissenschaftsgeschichte. Er analysierte in seinen Essays und Büchern die Herkunft und Geschichte von Metaphern und Mythen als Sinnressourcen und Reservoirs der europäischen Geistesgeschichte. Ein besonders eindrückliches Beispiel ist der elegante Essay „Schiffbruch mit Zuschauer“, der erstmals 1979 und jetzt wieder erschienen ist.
Blumenbergs Ausgangspunkt ist eine Paradoxie, die ihn zu seiner Spurensuche angeregt hat. Seit der Antike haben Menschen ihr Dasein mit paradoxen Wendungen umschrieben. Sie wählten, obwohl überwiegend Landbewohner, ausgerechnet Wörter aus dem Bereich der Seefahrt, um die Wechselfälle des persönlichen wie des öffentlichen Lebens zu bezeichnen. Wörter wie „Steuermann“, „Kommandobrücke“, „Leuchtturm“, „Sturm“, „ruhiger Hafen“, „Windstille“ und „Lotse“ wurden gewählt für „die Bewegung des Daseins.“ Den antiken Skeptikern und Epikureern galt „Windstille“ als eine Metapher für eine positiv besetzte Befindlichkeit. In der Moderne, insbesondere in der Geschäftswelt, änderte sich der Sinn der Metapher allerdings komplett.
Zu den beliebten Metaphern gehörte auch der „Schiffbruch“, der während Jahrhunderten als ebenso legitime wie normale Folge der Seefahrt angesehen wurde. Noch Ende des 19. Jahrhunderts gab es allein vor der britischen Küste pro Halbjahr 700 bis 900 Schiffbrüche mit jeweils über 2000 Toten. Die alte Erfahrung prägte sich jedoch unterschiedlich ins Gedächtnis ein. Der griechische Philosoph Aristipp (435 v.Chr. – 366 v. Chr.) war der Meinung, der Schiffbruch bringe die Menschen zum Nachdenken und mache sie zu Philosophen. Andere dämonisierten die Schifffahrt zur Sphäre der Unberechenbarkeit, die dem Menschen nicht gemäß sei. Noch Michel de Montaigne wies als Landedelmann im 16. Jahrhundert darauf hin, man könne selbst im Hafen untergehen und ertrinken. (…)
Die Aufklärung verabschiedete sich von dieser kontemplativen Weltsicht und stellte Schiffbrüche in den Kontext der Weltentdeckung und –eroberung. Neues findet nur, wer etwas wagt, sich Neugier bewahrt und sich aufs Meer begibt. Die Sicherheit des Hafens wird nun zum Ort der verpassten Entdeckung. Voltaire fasste dies in einer Antinomie: ohne Leidenschaft keine Bedrohung, ohne Bedrohung keine Leidenschaft: „Alles hier unten ist gefährlich, und alles ist nötig.“ Nicht mehr die Muße der Selbstvergewisserung als distanzierter Zuschauer ist es, die Erkenntnis fördert, sondern die Neugier – mit dem Risiko des Schiffbruchs. „Man macht überall Schiffbruch und landet im Rinnstein“ (Voltaire). Der Zuschauer ist nicht mehr Genießer wie bei Lukrez, sondern eingebunden ins moralisch positiv bewertete Handeln.
In der deutschen Klassik wurde der „Schiffbruch“ politisiert und gleichgesetzt mit der Französischen Revolution, der Herder nur „vom sicheren Ufer herab“ zuschauen wollte, aber befürchtete, „unser böser Genius“ könnte Deutschland dasselbe „Schicksal“ einbrocken. Aus aufklärend verstandener Selbstverständigung wurde Dämonenbeschwörung.
Die Geschichtsphilosophie Hegels sah den Zuschauer positiv als einen, der den notwendigen Gang der Weltgeschichte als Verwirklichung der Vernunft in der Geschichte reflektiert: Vom „ruhigeren Ufer“ aus erkennt der Zuschauer die Geschichte „als diese Schlachtbank, auf welcher das Glück der Völker, die Weisheit der Staaten und die Tugend der Individuen“ geopfert werden, was einzusehen wichtiger sei, als „in den leeren, unfruchtbaren Erhabenheiten jenes negativen Resultats sich trübselig zu gefallen.“
Für Goethe war dieser Rigorismus Menschverachtung, und der Historiker Jacob Burckhardt erkennt die Unmöglichkeit der Zuschauerrolle in der dynamisierten Geschichte der Moderne: „Derselbe Sturm, welcher seit 1789 die Menschheit fasste, trägt auch uns weiter.“ Im Gegensatz zu den wissenschafts- und fortschrittsgläubigen seiner Zeitgenossen glaubte er allerdings nicht, aus den Planken des untergehenden Schiffes ließen sich sozusagen auf hoher See neue Schiffe bauen.
Blumenberg verlängert die Geschichte der Metapher – ihre Moralisierung, Dämonisierung und Politisierung – nicht bis in die Gegenwart. Der Essay ist trotzdem ein außerordentliches intellektuelles Vergnügen.
Rudolf Walther, Frankfurt am Main